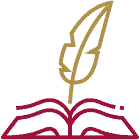-
- 02. Februar 2026
Wie moderner Weingenuss, bewusstes Masshalten und alkoholfreie Alternativen auch nach dem Dry January elegant zusammenspielen.
-
- 26. Januar 2026Jetzt ist es offiziell. Nach intensiven Degustationen steht der Sieger fest: Marqués de Murrieta 2021 ist der Mövenpick Wein des Jahres.
-
- 14. Januar 2026
Entdecken Sie Stellenbosch, Südafrikas Top-Weinregion, mit Pinotage, Cabernet Sauvignon und legendären Weingütern wie De Toren und Rustenberg.
-
- 05. Januar 2026
Im burgenländischen Andau hat die Familie Scheiblhofer ein Paradies für Wein- und Genussliebhaberinnen und -liebhaber geschaffen.
-
- 05. Januar 2026
7 genussvolle, alkoholfreie Getränke für einen entspannten Januar nach den Festtagen – leicht & lecker geniessen.
-
- 05. Januar 2026
Alkoholfreie Alternativen überzeugen mit voller Geschmacksvielfalt, ganz ohne Volumenprozente.
-
- 22. Dezember 2025
Unermüdliche Frauen prägten die Champagnerproduktion im Ersten Weltkrieg und hielten die Region trotz Zerstörung am Leben.
-
- 17. Dezember 2025
Champagner – das edle Extra zu Weihnachten und Silvester. Ein Blick auf den beliebtesten Schaumwein der Welt.
-
- 17. Dezember 2025
Bacio d'Oro: Der perfekte Wein zum Panettone. Entdecken Sie festlichen Genuss wie in Italien – Buon Natale!
-
- 17. Dezember 2025
Wie Temperatur den Geschmack von Wein verändert – und warum sie über Genuss oder Enttäuschung entscheidet.
© 2025 Mövenpick Wein Schweiz AG